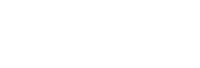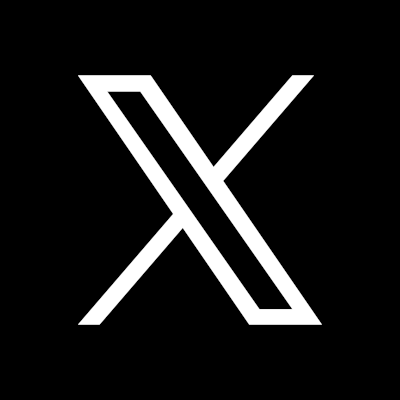- GU Home
- FB 09
- Institute
- ES
- Studium
- Studieninteressierte
- Schwerpunkte B.A.
- Indogermanische Sprachwissenschaft
- Studieninteressierte
- Schwerpunkte B.A.
- Afrikanische Sprachwissenschaft
- Allgem. Vergleichende Sprachwissenschaft
- Altorientalische Sprachen
- Baltische Sprachwissenschaft
- Digital Humanities
- Englische Sprachwissenschaft
- Indogermanische Sprachwissenschaft
- Japanische Sprach- und Kulturwissenschaft
- Kaukasische Sprachwissenschaft
- Klassische Sprach- und Literaturwissenschaft
- Phonetik
- Semitische Sprachen
- Skandinavische Sprachen
- Sprachen und Kulturwiss. des Judentums
- Sprache und Kultur Koreas
- Sprachen und Kulturen Südostasiens
- Bewerbung M.A.
- Schwerpunkte B.A.
- Studierende
- FAQs
- Institutsgruppe
Indogermanische Sprachwissenschaft
Was macht man im Schwerpunkt Indogermanische Sprachwissenschaft?
Was erwartet diejenigen, die sich für den Schwerpunkt Indogermanische Sprachwissenschaft entscheiden?
Im dritten Semester lernst du dann, wie man mit der komparativen Methode die Grammatik des Urindogermanischen rekonstruiert. Im Modul indogermanische Formenlehre geht es also darum, welche grammatischen Kategorien (zunächst Arten von Nominal- und Verbformen) die indogermanische Ursprache hatte und wie sie sich entwickelt haben. Dieses Modul wird in einem Semester nach einer Vorlesung mit dazugehöriger Übung mit einer Klausur abgeschlossen.
Neben diesen grundlegenden Veranstaltung lernst du in den ersten Semestern auch die ersten altindogermanischen Sprachen kennen.
Würde es ein Ranking der indogermanischen Sprachen geben, bei denen es Punkte gleichermaßen für möglichst frühe textliche Bezeugung und möglichst viel Textmaterial gibt, wäre Sanskrit mit Sicherheit an erster Stelle. Diese altindische Sakralsprache (sie wird bis heute im Hinduismus im Gottesdienst verwendet) wurde ungefähr im 4. Jh. v. Chr. festgehalten und regularisiert, enthält aber noch viel älteres Sprachmaterial. Gleichzeitig gibt es eine unschätzbare Fülle an Texten in dieser Sprache, was nicht bei allen so alten Sprachen der Fall ist. Dementsprechend fußt besonders die Formenlehre der rekonstruierten Ursprache besonders stark auf Sanskrit, weshalb alle Indogermanisten sich mit dieser Sprache auseinandersetzen müssen – und mit Blick darauf, dass bei uns die Formenlehre meist im dritten Semester besucht wird, sollte Sanskrit möglichst im ersten Semester begonnen werden.
Was kann man damit nach dem Abschluss machen?

Es bietet sich an nach dem B.A.-Abschluss einen Master in Indogermanischer Sprachwissenschaft anzuschließen. Wenn Empirische Sprachwissenschaft im HF belegt wurde (4-semestriger Bachelor), dann ist in Frankfurt lediglich ein 2-semestriger Master zu absolvieren. Ein Masterabschluss ermöglicht eine anschließende Promotion und Tätigkeit an Universität bzw. Forschungseinrichtungen.
Auch im außeruniversitären Bereich sind vielfältige Berufsfelder denkbar. Je nach Richtung können und sollten im Rahmen der Wahlpflichtmodule bereits entsprechende berufsfeldorientierte Kompetenzen erworben werden. Mögliche Berufsfelder umfassen:
- Fortbildung / Personalarbeit: Training und Schulung mündlicher und schriftlicher Kommunikation, Kommunikationsberatung, Coaching, Moderation;
- Interkulturelle Kommunikation: interkulturelles Training und Mediation: I. interkulturelle Kommunikationstrainer, z. B. Vermittler internationaler Teams, II. Mediatoren, Einsatz bei Konflikten, deren Ursachen in kulturellen Unterschieden liegen, III. Berater und kulturelle Mittler, Erschließung von Auslandsmärkten oder Maßnahmen zur Integration von Ausländern;
- Presse / Medien / Public Relations: Medienkonvergenz, Umgang mit Text, Bild, Ton, Film, Grafik, Hypertext, praktische Erfahrung im Schreiben, Textgestalten, Redigieren und Moderieren;
- Technische Dokumentation: technischer Redakteur, Übersetzer oder Lektor, Darstellung jeglicher Informationen über technische Produkte;
- Computer / Software / Neue Medien: Softwareentwicklung, Planung, Entwicklung und Realisierung von Hypertexten und Hypermedia sowie deren Vermittlung, Entwicklung von Lehr- und Lernsystemen;
- Klinische Linguistik: Diagnostik und Therapie neurogener Sprach- und Sprechstörungen, Qualitätsmanagement, Aus- und Fortbildung, Forschung und Methodenentwicklung;
- Dolmetschen / Übersetzen (neue Bedeutung durch explosionsartige Bedarfsentwicklung auf fachlichem Gebiet);
- Sprachunterricht (Mutter- und Fremdsprachen): Schuldienst, Alphabetisierungskurse.
Quelle: Becker-Mrotzek, Michael / Brünner, Gisela / Cölfen, Hermann (Hg.) Linguistische Berufe. Ein Ratgeber zu aktuellen linguistischen Berufsfeldern. Frankfurt/M. u.a.: Peter Lang 2000.
- Aktuelles und Presse
- Pressemitteilungen
- Öffentliche Veranstaltungen
- Uni-Publikationen
- Aktuelles Jahrbuch
- UniReport
- Forschung Frankfurt
- Aktuelle Stellenangebote
- Frankfurter Kinder-Uni
- Internationales
- Outgoings
- Erasmus / LLP
- Goethe Welcome Centre (GWC)
- Refugees / Geflüchtete
- Erasmus +
- Sprachenzentrum oder Fremdsprachen
- Goethe Research Academy for Early Career Researchers
- Forschung
- Research Support
- Forschungsprojekte, Kooperationen, Infrastruktur
- Profilbereich Molecular & Translational Medicine
- Profilbereich Structure & Dynamics of Life
- Profilbereich Space, Time & Matter
- Profilbereich Sustainability & Biodiversity
- Profilbereich Orders & Transformations
- Profilbereich Universality & Diversity